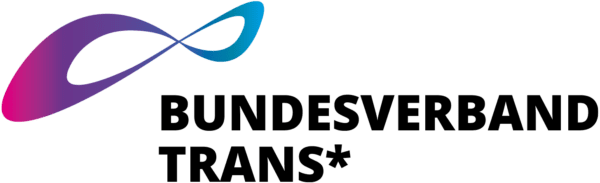Am 10. September 2017 reagierte das Bundesverfassungsgericht auf die Beschwerde der inter Person Vanja und fasste einen wegweisenden Beschluss. Darin wurde klar benannt: Die damalige rechtliche Lage, die nur die Personenstände „weiblich“, „männlich“ und einen gestrichenen Geschlechtseintrag vorsah, war verfassungswidrig. Aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts gab es zwei Alternativen: Entweder wird mindestens ein weiterer positiver Eintrag geschaffen oder Deutschland beendet die Erfassung von Geschlecht generell, damit keine weitere Ungleichbehandlung stattfindet.
Kalle Hümpfner vom BVT* sagt dazu: „Dass das Bundesverfassungsgericht die gleichwertige rechtliche Anerkennung von nicht-binären Identitäten so deutlich eingefordert hat, war ein riesiger Erfolg. Gleichzeitig war es ein enorm wichtiger Schritt für die Auseinandersetzung mit geschlechtlicher Vielfalt in diesem Land. Für viele Personen, die bislang unsichtbar gemacht wurden, bedeutete der Beschluss sowohl Empowerment als auch die Hoffnung auf rechtliche Anerkennung.“
Trans*, inter und nicht-binäre Aktivist*innen setzten sich im Anschluss unter dem Kampagnentitel „Aktion Standesamt 2018“ für eine menschenrechtskonforme Umsetzung ein. Denn mit dem Beschluss war ein Auftrag an die Gesetzgebung ergangen, bis Ende 2018 in dieser Hinsicht tätig zu werden. Die damalige Bundesregierung verständigte sich letztlich auf einen Minimalkonsens. Folge war die Einführung des Paragrafen 45b Personenstandsgesetz (PStG) und damit verbundenen die Einführung des Geschlechtseintrags ‚divers‘. Von Anfang an stand die Regelung in der Kritik, da nur gegen Vorlage eines medizinischen Attests Vornamen und Geschlechtseintrag angepasst werden können. Ebenso wird kritisiert, dass durch das gleichzeitige Fortbestehen des sogenannten Transsexuellengesetzes (TSG) neben dem Paragrafen 45b PStG trans*, inter und nicht-binäre Personen nun zwei unterschiedlichen Rechtsgrundlagen ausgesetzt sind, um Vornamen und Geschlechtseintrag zu ändern. Aktuell liegt dem Bundesverfassungsgericht erneut eine Beschwerde vor, um zu prüfen, ob dies eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung darstellt.
Kalle Hümpfner sagt hierzu weiter: „Wir sind auf halber Strecke stehengeblieben. Seit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in 2017 ist einiges in Bewegung gekommen. Als Folge wurde die Frage nach der korrekten Ansprache von nicht-binären Personen für breite Teile der Bevölkerung relevant. Der Zusatz „m/w/d“ oder „m/w/d/x“ in Stellenausschreibungen verweist mittlerweile an vielen Stellen auf Nichtbinarität. Der Beschluss ebnete auch den Weg für weitere Gerichtsverfahren, in denen nicht-binäre Personen sich gegen erfahrene Diskriminierung zu Wehr setzten. Doch wir sind noch lange nicht am Ziel. Es darf nicht sein, dass die Akzeptanz und Gleichberechtigung von nicht-binären Personen nur vor den Gerichten erkämpft werden können. Die Regierung muss nun den Worten aus dem Koalitionsvertrag Taten folgen lassen. Aus den Eckpunkten zum Selbstbestimmungsgesetz muss ein Referentenentwurf werden – und zwar bald.“
Das geplante Selbstbestimmungsgesetz würde nicht nur Pathologisierung und bürokratische Hürden bei Änderung von Vornamen und Geschlechtseintrag beenden, sondern eine einheitliche Regelung für trans*, inter und nicht-binäre Personen schaffen. Als die amtierende Regierung im Juni die Eckpunkte des Gesetzes vorstellte, war der Jubel in den Communities groß. Ein Referentenentwurf soll voraussichtlich bis Ende des Jahres den Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt werden.
Links
Hier findet sich der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 10.10.2017 (1 BvR 2019/16).
Zudem hat das OLG Frankfurt bereits zwei Mal klagenden nicht-binären Personen recht gegeben: Eine binäre Anrede ist nicht zulässig (AZ 9 U 84/21) und hat laut einem Urteil gegen die Deutsche Bahn sogar Schadenersatzansprüche zur Folge (AZ 9 U 92/20).
Diese Pressemitteilung kann hier als PDF heruntergeladen werden.